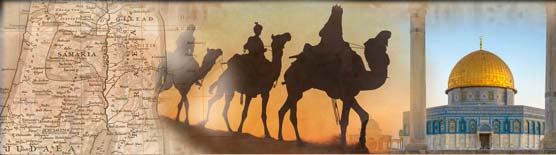Israel 1967 – Krieg und Umwelt
Der Sender schickte mich in den Nahen Osten. Gute Ratschläge gab er mir nicht mit, ich musste mich selbst durchbeißen, und das war nicht leicht, denn ich gehörte einem Jahrgang an, der belastet war durch die unselige Geschichte des Ditten Reiches mit dem entsetzlichen Holocaust. Die Israelis hatten mich kritisch geprüft am Frankfurter Flughafen, wo am Flugfelde die Panzer drohten, und ich hatte Angst vor der Begegnung mit Menschen, die meine Regierung einst mit dem Tode bedrohte. Hier in Israel spürte ich über all den bitteren Krieg, den 6-Tage-Krieg des Jahres 1967, in dem Israel unter hohen Verlusten seine starken arabischen Nachbarn schlug und die Sinaihalbinsel bis zum Suezkanal besetzte und die Altstadt von Jerusalem. Das kleine Land war dabei, sich von diesem Krieg zu erholen, die Wunden zu lecken. Ich saß im Taxi vom Flugplatz nach Tel-Aviv, da erzählte mir der Driver in allen Farben berlinischer Beredsamkeit, wie er bei Ausbruch des Krieges, und als das Radio das Geheimsignal Orange
sendete, an den Ort des Einsatzes geeilt sei und die Taxe voller Soldaten, kostenlos versteht sich, an die Front gefahren hatte. Der Driver ließ mich nicht spüren, dass ich der Feind sei. An den Straßenrändern standen zerfetzte LKW und Tanks und Geschütze, überall die Fahnen Israels und neue Denkmale. Das Land schien im Rausch zu liegen und ich fühlte mich angesteckt. Die Menschen auf den Straßen strahlten und waren freundlich zu mir und hilfsbereit wie der Friseur aus Breslau, der mir die Haare schnitt und alles noch einmal erzählte. Ich fand ein kleines Vorstadthotel. Den Nachtdienst versah ein freundlicher junger Student, der damit seine Semestergebühren bezahlte. Wir kamen ins Gespräch, über die Vergangenheit, über den nächsten Krieg, an dem er vielleicht teilnehmen würde.
Am nächsten Morgen eine Vorstadtstraße in Tel-Aviv. Das Schild mit der hebräischen Bezeichnung Keren Kayemet
. Herr Glücklich begann zu erzählen: Wenn wir als Kinder früher mit dem Bus nach Jerusalem fuhren, dann zählten wir die Bäume an der Landstraße. Jeder Baum war eine Überraschung, so wenige gab es
, sagte der Chef der Wiederaufforstung Israels. Seit vielen tausend Jahren ist Israel ein Durchgangsland für ungezählte Völkerscharen. Heute ist es Heimat. Wir müssen an Landschaft retten, was noch zu retten ist. Wir haben Eukalyptusbäume in Australien gekauft und Pinien. Seit 1948 haben wir 100 Millionen Bäume gepflanzt und schon haben wir Probleme mit Waldbränden.
Das wollte ich genauer betrachten und fuhr durchs Land. Und sah, warum Herr Glücklich so stolz ist. Der Unterschied zwischen den grauen Steinhügeln jenseits der Grenze in Jordanien und dem bunten Mischwald diesseits überzeugte nicht nur den Naturfreund. Pinien hatten der Erosion Einhalt geboten. Zwischen nacktem Gestein bildete sich eine dünne Humusschicht. Schon jetzt sollte hier stellenweise das Klima feuchter sein.
Israel hatte – wie wir in Norddeutschland, einen Tag des Baumes
Rashut Schmuroth Hateva, und an einem solchen ging ich mit dem Forstwirt Chaim Blass in die gut eingerichtete Forstschule Esthahol und ließ mir die Beete mit den Fichten- und Eichensetzlingen zeigen, die hübsch gekleidete Mädchen gebracht hatten.
Weiter zu einem Haus in Tel-Aviv. Es öffnete Abram Joffe, Armeegeneral außer Diensten, kam eben aus dem Feld, herrisch, kurz angebunden. Ich sagte mein Sprüchlein auf, von wegen Naturschutz im Lande. Das Kriegerauge wurde mild. Naturschutz war der neue, noch ungewohnte Beruf des Generals, eben ernannt zum obersten Naturschützer Israels. Aus dem Saulus war ein Paulus geworden, denn Joffe galt vor kurzem noch als großer Nimrod vor dem Herrn, der nur zu gern Böcke im Negev geschossen hatte. Die ließ er nun zufrieden und fuhr mit mir weit gen Norden ins Tal von Huleh und mit dem Kahn übers Wasser, wo man weit hinten versteckt die schwarzen Herden der Büffel sah. Er zeigte mir den hohen Papyrus, der in diesem milden Klima sein nördlichstes Vorkommen hat und das Gewusel der Zugvögel auf den kleinen Wellen des Huleh-Sees, weil hier ein wichtiger Rastplatz ist. Friedlich glitten wir übers Wasser, ich staunte über braunerdige Schildkröten und hungrige Welse. Fühlte Bewunderung für ein Land, das sich neben den teuren Kriegen noch den gewiss nicht billigen Naturschutz leistet. Auch die Probleme der modernen Agrarchemie standen im Licht. Im Zoo von Tel-Aviv, das waren nur ein paar Käfige, sehr bescheiden noch – zeigte mir der quirlige Professor Heinrich Mendelssohn Raubvögel mit dick geschwollenen Beinen. Sie hatten Mäuse geschlagen, die vollgepumpt waren mit dem DDT, das die Kibbutzbauern bei Nablus auf ihre Orangenhaine spritzten, wohl wissend, dass DDT international längst gebannt war. Ich sah Nablus, und ich war entsetzt. Überall an den Rändern der Orangenhaine standen Schilder mit Totenköpfen als Warnung vor dem Gift.
Forschung und Wissenschaft im Lande wurden schon zu Beginn des Staates dominiert von den Jeckes
, von Europäern, vorwiegend Deutschen, die nach 1933 eingewandert waren auf der Flucht vor den Nazis und nun auf den Lehrstühlen der Universitäten und in den Instituten saßen und arbeiteten, wie sie es aus Europa gewohnt waren, sorgfältig, genau, eben deutsch. Sie haben gewiss das geistige und organisatorische Leben des Landes entscheidend mitgeprägt. Dr. Benno Rothenberger in Ramat-Aviv gehörte dazu, jener Archäologe, der die Welt auf die uralten Schätze im Tal von Timna aufmerksam gemacht hatte, wo man schon zur Zeit der Pharaonen nach Kupfer gegraben hatte. Und Dr. Hugo Boyko gehörte dazu, wie seine Kollegin Dr. Marbach in Rehovot. Sie zeigten mir in Eilat die Ergebnisse ihrer neuen Bewässerungstechnik – mit mildem Salzwasser, das war unerhört in den Ohren normaler Techniker. Aber sie gelingt auf tiefen Sandböden, wo das Salz an den Wurzeln vorbei in die Tiefe geht und nur reines Süßwasser die Pflanzenwurzeln erreicht. Ich sah die salzwasserbesprühten Juncusfelder und die gedeihenden Wälder am Stadtrand von Eilat. Eine andere Technik zur Bekämpfung der Wassernot zeigte Erika aus Bottrop mir im Kibbutz der Quelle En Gedi; die Studentin führte mir ihre gepflegten roten Rosen vor, die prächtig gediehen im plastikversiegelten Gewächshaus, in dem ein Wasserkreislauf ohne Verlust funktionierte. Doch ich musste weiter im Heiligen Land.
Eine graue Staubfahne zog mein Jeep hinter sich, denn die Straße von Beer-Sheba nach Eilat führt durch die Halbwüste Negev und ist bestimmt keine glatte Autobahn. Gegen Abend tauchte rechts eine verlassene Bushaltestelle auf. Hinter den flachen Gebäuden ragt ein Berg hoch hinauf in den Wüstenhimmel, und jedermann im Lande kennt seine Silhouette, es ist die uralte Kreuzfahrer Festung Avdat. Gegenüber hat man eine Wetterstation und eine Forschungsstelle errichtet. Das Geheul der Wachhunde beruhigte sich erst, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass ich keinen Überfall plane, wie Beduinen von drüben
das hin und wieder tun.
Mich begrüßte im kultivierten Deutsch Professor Michael Evenari von der Hebräischen Universität Jerusalem, er war Wüstenökologe. Bei kühlem Tee erzählte er mir von der Geschichte des Negev, dem Südland
der Bibel. Um 250 vor Chr. erscheinen südarabische Karawanenhändler – die Nabatäer. Der Handel machte sie reich, und sie errichteten befestigte Stützpunkte und Städte entlang ihrer Handelsstraßen. Das zauberhafte Petra war ihre Hauptstadt. Sie gründeten Avdat und betrieben eine umfangreiche Bewässerungslandwirtschaft. Im heutigen Israel versucht die Forschung, eine landwirtschaftliche Anbautechnik zu rekonstruieren, die diese Vorfahren vor 2800 Jahren erfanden. Dabei ist erwiesen, dass es damals im Negev nicht mehr Regenwasser gab als heute, nämlich im Durchschnitt 80 Millimeter, das ist sehr wenig.
Das Geheimnis lag in der Eigenschaft des Lößbodens. Fällt Regen, so bildet er eine dünne Kruste, die kein Wasser durchlässt. Das Wasser läuft vielmehr die Hänge hinab. Man nennt das eine Flut. Die Nabatäer haben sich Fluten zunutze gemacht. Sie sammelten das ablaufende Wasser in steinumsäumten Kanälen und leiteten es auf tiefer liegende Felder. Nach der Flut hat sich jede der steinernen Terrassen in einen Teich verwandelt. Das Wasser sickerte langsam in den Boden. 30 Zentimeter Wasser genügten, um 2 Meter Lößboden mit Wasser zu durchtränken, damit hatten die landwirtschaftlichen Gewächse Wasser für ein Jahr. Evenari lachte: Es ist keine Sage: Damals wuchsen Trauben im Negev! Er will keine Weintrauben, aber grüne Flächen mit Weidegras, Spargel, Artischocken. Blühende Kirschbäume bildeten einen reizvollen Kontrast zur graugelben Ruine der Nabatäerburg. Aber die Widerstände im Lande gegen den Deutschen waren heftig. Ingenieure fanden Evenaris Methode unzuverlässig, sie bauten auf große Wasserleitungen, die sie legen wollten vom See Genezareth bis weit in den Süden. Heute würde man Evenaris Ideen nachhaltig
nennen. Natürlich brachte mich die junge Dame aus dem Hotel auch an den Heiligen See Genezareth, und ich fragte mich, warum um Himmelswillen geben einem die Sender so wenig Zeit? Auf der Station Tapra trafen wir den Ranger Juda Nero, der mir mit kühlen Worten die Probleme des Süßwassersees erklärte. Er träumte von einer Frischwasserleitung in den Süden. Von den alten Nabatäern und ihren Wasserkünsten und von dem deutschen Botaniker wollte der Ingenieur nichts wissen.